Validation
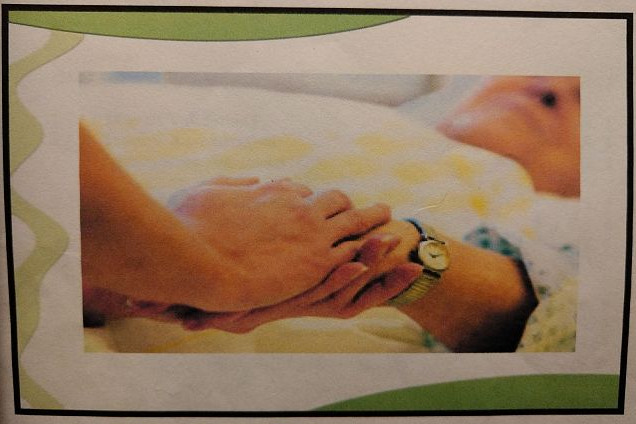
"Trotzdem in Würde Leben"
Eine neue Perspektive in der Validation für Demenzkranke Menschen
Was ist Validation
Validation, nach Naomi Feil, ist:
- eine Entwicklungstheorie, die besagt, dass es für Menschen angemessen ist, Bezug zu ihrer Vergangenheit, und so nicht bewältigte Lebenskonflikte versuchsweise noch gelöst werden, bevor sie sterben.
- eine Methode der Kommunikation mit Menschen, die verbale und nonverbale Techniken umfasst.
- eine spezifische Technik, die dem Menschen hilft, durch individuelle Validation ihre Würde zu erhalten oder wieder zu gelangen.
(Validation, Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Mensche 1999, S. 11)
Im Ergebnis kann durch Validation das Leben dieser alten Menschen an Qualität gewinnen.
Das Verb "validieren", bedeutet soviel wie anerkennen, bejahen, jemand sein Recht zuerkennen, in seinem Recht bestätigen. Auch wenn die Mitteilung, die dieser Mensch macht, wörtlich genommen keinen Sinn zu ergeben scheint, wendet ihr der Validationanwender volle Aufmerksamkeit zu, er nutzt die Kommunikationstechniken der Validation.
Durch die Validation versucht man den desorientierten alten Menschen nicht zu verbessern, sondern sich in die innere Realität rein zu versetzen, damit sie ihre Verluste und Ängste besser verarbeiten können. Bevor der/die Validator/in mit der Validation anfängt, muss er/sie sich von allem, was ihn beschäftigt lösen.
Beispiel: Alle Gedanken, die man im Kopf hat in eine Schublade stecken und schließen, den Kopf frei machen. Man braucht viel Einfühlungsvermögen um in die innere Erlebniswelt zu gelangen (in die Schuhe des desorientierten alten Menschen steigen) Einfühlungsvermögen schafft Sicherheit, Sicherheit schafft Stärke und Stärke stellt das Selbstwertgefühl wieder her. Man kann sich dann voll und ganz auf den Menschen konzentrieren (sich in ihn Reinversetzen).
Validation ist also ein Weg, um mit alten Menschen zu kommunizieren, die bereits viele Möglichkeiten der üblichen Kommunikation verloren haben. Es ist eine Form die, die erkrankte Person in ihrem So-Sein annimmt und bestätigt. Es macht dem dementen Menschen deutlich, "Du bist in Ordnung, so wie du bist. Ich versuche, dich zu verstehen. Du bist mir wichtig, es ist mir wichtig, wie du dich gerade fühlst".
Die Validation besteht aus vier Phasen:
1. Phase Mangelhaft Orientiert:
- Die Phase kann sich noch zeitlich und räumlich Orientieren.
- Die Bewegung des Körpers sind zielgerecht
- Sie vermeiden Intimität und wollen auch nicht berührt werden
Menschen mit mangelhafter Orientierung sind nicht desorientiert im Sinne von Ort und Zeit. Sie wissen sehr genau wo sie sind und wie viel Uhr es ist. Sie meiden diejenigen Menschen, die wirklich desorientiert und verwirrt sind. Sie klammern sich an jedes kleine Stück Realität. Sie haben große Angst genau so zu werden, wie diese anderen Menschen.
Körperliche Berührungen sind Menschen mit mangelhafter Orientierung sehr unangenehm. Sie haben auch Mühe, jemanden direkt in die Augen zu schauen. Sie achten immer darauf, dass gebührend Abstand zwischen ihnen und den anderen bleibt. Sie verließen ihre Gefühle fest in sich. Sie brauchen eine vertrauensvolle Beziehung, einen fürsorglichen, respektvollen Umgang, eine Person, die ihnen nicht widerspricht, die sie verstehen, nicht beurteilen oder gar verurteilen. Wenn sie richtige Begleitung bekommen, ziehen sie sich nicht so stark in sich zurück.
2. Phase Zeitverwirrtheit:
- Die Personen verwechseln Vergangenheit und Gegenwart
- Erkennen ihre Angehörigen nicht
- Die Bewegung ist langsam und laufen ziellos umher
Bei Menschen in dieser Phase verwirrt sich die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes.
Die reale Zeit, in der ihre Umwelt lebt, und die Zeit, in der sie Leben, fallen auseinander.
Sie beginnen den Bezug zu den anderen und der "wirklichen Welt" zu verlieren. Sie Leben in der Vergangenheit, wobei die Gegenwart und Vergangenheit sich manchmal vermischen. Sie messen die Zeit in Erinnerungen, nicht in Stunden oder Minuten. Ihre Gedanken hängen nicht mehr logisch zusammen. Zeitverwirrte Menschen wollen oft nach Hause, manchmal auch zur Schule oder an die Arbeit.
Beispiel: ein Arzt wird zu seinem Sohn, die Pflegeperson ihre Mutter oder andere Vertrauteren aus der Vergangenheit.
Im Gegensatz zu mangelhaft orientierten Menschen der 1. Phase, reagieren zeitverwirrte Menschen auf Augenkontakt und brauchen Berührungen. Bei falschem Umgang besteht die Gefahr, dass sich zeitverwirrte Menschen noch stärker nach innen kehren, dass sie noch verwirrter werden und immer weniger Bezug zur realen Welt haben. Sie gleiten ab in die Phase sich - wiederholender - Bewegungen und schließen ins Vegetieren.
3. Phase Sich wiederholende Bewegung:
Rhythmus und Bewegung beherrschen die Sprache
- Sie benutzen wiederholende Bewegungen, um Gefühle auszudrücken
- Sie weinen, klopfen, schlagen auf Gegenstände, gehen auf und ab oder wiegen sich
Menschen in dieser Phase haben zum größten Teil die Sprachfähigkeit verloren. Die abstrakten Begriffe der Sprache ersetzen sie durch Kombinationen von Lauten, die durch Bewegungen der Lippen und des Kiefers erzeugt werden. Diese Menschen erfinden eigene Worte, ohne logischen Zusammenhang.
Beispiel: sagt eine Frau: "Das ist fosi, fosi." Mache sprechen gar nicht mehr, andere summen ein Lied oder es kommen immer dieselben Wörter aus einem Gebet hervor. Manche Menschen in dieser Phase gehen in rhythmische Bewegungen über, die Ihnen aus der Vergangenheit bekannt sind.
Beispiel: Sie schaukeln mit dem Oberkörper hin und her, damit suchen sie Geborgenheit; ein ehemaliger Tischler schlägt die ganze Zeit mit der Hand auf den Tisch, oder eine Näherin die, die Naht an ihrem Kleid glatt streicht, oder eine andere wiegt die Arme hin und her (sie hält ihr Baby im Arm).
Die Menschen in der Phase der sich wiederholenden Bewegungen wird oft angenommen, dass sie keine emotionalen (vom Gefühl bestimmt) Bedürfnisse mehr haben. Sie sehen durch einen hin durch, man hat das Gefühl, dass sie nichts mehr wahrnehmen. So werde sie auch in der Phase oft routinemäßig abgefertigt, weil sie keine Wünsche anbringen. Diese Menschen zeigen aber Reaktionen auf Blickkontakt, wenn man ihr Verhalten spiegelt, ihnen viel körperliche Berührung gewährt, (Berührungen wecken Hirnzellen) oder ein Lied aus früheren Zeiten singt. Meine Erfahrung zeigte, dass eine Frau, die kein Wort mehr sagte, mitzusingen begann bei dem Lied: "Wenn der weiße Flieder wieder blüht...".Von Verwandten wusste ich, dass dies ihr Lieblingslied gewesen ist.
Menschen in dieser Phase sprechen zwar nicht mehr zusammenhängend, aber sie Fühlen und nehmen die Empathie wahr. Wenn man diese Menschen sich selbst überlässt, zu wenig Berührung spendet, keinen Kontakt aufnimmt, schließen sie die Augen und fallen ins Vegetieren.
4 Phase Vegetieren:
Totaler Rückzug nach innen
- Die Augen bleiben geschlossen
- Die Muskeln sind schlaff
- Ihre Körper sind zusammengesunken. Unbeweglich oder bewegen sich kaum
- Sie drücken kaum mehr Empfindungen aus und sind nicht mehr in der Lage, von sich aus etwas zu tun
Die letzte Phase der Aufarbeitung nennen wir Vegetieren, ein Zustand, bei den die betreffende Person total in sich zurückgezogen ist. Diese Menschen gelangen aus ganz verschiedenen Gründen in diese Phase: Einschränkung der Bewegungsfreiheit usw. Sie liegen wie ein Embryo in ihrem Bett, in sich zusammen gekauert, fast ohne erkennbare Kommunikation, scheinbar ohne Reaktion, abgekapselt, verloren.
Deshalb tun wir alles, um mit der Methode Validation das Eintreten in diese Phase zu verhindern.
Die Ziele der Validation sind:
- Wiederherstellung des Selbstwertgefühls
- Minderung von Stress
- Lösen der unausgetragenen Konflikte aus der Vergangenheit (bei Frauen, Vergewaltigung in den Kriegsjahren usw.)
- Verbesserung der verbalen und nonverbalen Kommunikation
- Verhindern eines Rückzugs in das Vegetieren
- Verbesserung des Gehvermögens und des körperlichen Wohlbefindens
Diese verbalen und nonverbalen Techniken der Validation beschreibe ich in Anlehnung an das Buch von Naomi Feil "Validation in Anwendung und Beispiel", 2000 und aus dem Buch "Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen", 1999, sowie aus eigener Erfahrung und eigenen Beispielen.
Verwenden sie eindeutige, nichtwertende Wörter, um Vertrauen herzustellen
Die ist zweite Technik der Validation ist, sachliche Fragen zu stellen. Dies ist besonders wichtig bei Menschen mit mangelhafter Orientierung. Bei ihnen wissen wir, dass sie Angst vor Gefühle haben. So stellen wir ganz konkrete Fragen nach Einzelheiten mit:
"Wer?, Was?, Wie?, Wo? Jedoch nie mit "warum". Personen mit mangelhafter Orientierung möchten nicht über Gründe nachdenken und schon gar nicht mit uns darüber sprechen.
Beispiel: eine alte Frau sagt: „Jemand hat meine Tasche gestohlen“, frage ich: „Wie sieht denn die Tasche aus, die ihnen fehlt?“ Und „wann haben sie bemerkt, dass ihnen die Tasche fehlt?“ Und „wann haben sie bemerkt, dass ihnen die Tasche fehlt?“ Ich frage konkret und ich bekomme meistens auch konkret Antwort. Diese Fragen nach genaueren Umständen können bei Personen mit mangelhafter Orientierung Vertrauen bringen. Sie haben nicht das Gefühl unglaubwürdig zu sein. Sie fühlen sich ernst - und angenommen und dass es durchaus berechtigt ist, sich zu beklagen, wenn sie etwas Wertvolles verlieren. Ich konfrontiere sie nicht mit ihren persönlichen Vermutungen. Ich akzeptiere, was sie sagt, weil es für dieses Verhalten einen Grund gibt, auch wenn ich ihn nicht kenne oder nachvollziehen kann.
Wiederholen
Die dritte Technik heißt „ Wiederholen“. Wiederholen ist mehr als aktives Zuhören, vorausgesetzt, dass ich meine Stimme und den Sprechrhythmus dem Menschen anpasse.
Die Gefühle, die in meiner Stimme sind, sollen spiegeln wie der andere fühlt. Das ist Empathie
(in die Person sich reinversetzen). Ich versuche nicht, was ich gehört habe in eine andere Richtung zu fühlen oder gar abzuschwächen.
Beispiel: Wenn eine Bewohnerin sagt:“ Ich will sterben“, dann versuche ich den Ton in der Stimme dieser Bewohnerin anzupassen. Wenn sie mit leiser Stimme und langsam gesprochen hat, frage ich langsam und mit leiser Stimme: „Sie meinen, Sie möchten nicht mehr leben?“ Vielleicht erzählt die Bewohnerin dann, wie das Leben für sie jetzt ist. Sie kann ihre Gefühle ausdrücken und es hört ihr jemand zu ohne sie auf andere Gedanken bringen zu wollen.
Sich das Gegenteil vorstellen
Diese Technik besteht darin sich das Gegenteil vorzustellen. Die Person soll sich das Gegenteil der Situation vorstellen, über die sie sich gerade beklagt.
Beispiel: Eines Abends läutet eine Bewohnerin und weinte, weil ein starkes Gewitter herrschte. Ich fragte sie: „Gab es Zeiten, wo ihnen das Gewitter nichts ausmachte?“ Sie antwortete: „Ja, früher hatte ich keine Angst davor, weil meine Mutter mit mir gebetet hat“. Da sie Vertrauen zu mir hat, konnte ich als Ersatz für die Mutter, mit ihr beten.
Wenn man sich in ihrer Lage versetzen kann, kann man das Gespräch zu einem positiven Schluss führen.
Erinnern
Erinnern finde ich persönlich eine interessante Technik, weil man damit von den Menschen aus der Vergangenheit viel erfährt. Ich möchte jeweils so viel wie möglich über ihr Leben erfahren, denn dies kann zu einer Lösung des Problems beitragen.
Ich fragte in Anwendung dieser Technik: „Gab es Zeiten, wo Ihnen das Gewitter nichts ausmachte?“ Die Bewohnerin hat sich an früher erinnert und selbst die Lösung gefunden.
Für alte Menschen ist es etwas ganz Natürliches, in Erinnerungen einzutauchen. Ich muss aber erst Vertrauen aufbauen damit dieser Mensch mir aus seiner Vergangenheit erzählt. Nicht jeder allerdings ist glücklich, wenn er zurückdenkt. Menschen wünschen sich nur jemanden, dem sie von ihren Gefühlen erzählen können, um die loslassen zu können.
Das bevorzugte Sinnesorgan erkennen und ansprechen
Diese Technik ist eine Herausforderung und braucht große Fähigkeiten im Zuhören und Beobachten.
Jeder Mensch hat schon von Kind an eine bevorzugte Sinneswahrnehmung. Bei desorientierten Menschen kann es hilfreich sein, wenn wir ihren bevorzugten „Sinn“ kennen.
Es erleichtert die Kommunikation und schafft Vertrauen. Um herauszufinden welcher „Sinn“ dem Bewohner eigen ist beobachte ich wie die Person ihre Hände, Augen, Ohren gebraucht.
Am besten kann ich darauf achten, wenn mir die Person etwas aus der Vergangenheit erzählt.
Beispiel: Wenn mir eine Bewohnerin sagt: „Ich sehe einen Hund in meinem Zimmer“, dann frage ich: „Wie sieht er denn aus? Welche Farbe hat sein Fell‘?“ wenn wir dieselben „Sinne“ ansprechen kann das Vertrauen eher aufgebaut werden.
Mit teilnahmsvollem Ton sprechen
("Der Ton macht die Musik")
Beobachten der Emotionen
Diese Technik eignet sich besonders bei zeitverwirrten Menschen und in der Phase der sich wiederholenden Bewegungen. Sie drücken ihre Bedürfnisse durch Bewegungen aus. Ich beobachte also genau ihre Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Atmung. Hierzu muss ich mich Zentrieren und zu meinem eigenen Gefühl Abstand gewinnen. Um ihre Gefühle aufzunehmen.
Beispiel: Eine Frau sitzt im Flur und ruft aufgeregt mit kräftiger Stimme:„Das ist Friedo.“ Ich gehe auf sie zu, nehme ihre Aufgeregtheit auf und frage mit ebenso kräftiger Stimme:
„Frau G. „das" regt sie sehr auf? Frau G. spürt dann, dass sie gehört wird, nimmt mit mir Blickkontakt auf und ich kann weiter fragen. Wenn ich ihre Emotionen aufnehme kann ich auch die richtigen Fragen stellen.
Spiegeln
Hier handelt es sich um eine nonverbale Technik, die vor allem bei Menschen in der dritten Phase angewendet wird. Spiegeln heißt, den Menschen mit dem ich kommunizieren möchte in seinen Bewegungen und seinem Verhalten nachzuahmen.
Beispiel: Eine Frau läuft den ganzen Tag auf dem Flur hin und her. Ich laufe im selben Schritt mit, nehme ihre Atmung, ihren Gesichtsausdruck, ihre Körperhaltung auf. Sie nimmt mit mir Kontakt auf, weil sie merkt das jemand ist wie sie. Wenn dies gelingt, kommt man diesen Menschen näher und kann sie besser verstehen und begleiten.
Verhalten mit einem Grundbedürfnis in Verbindung bringen
Diese Technik besteht darin das Verhalten der Person mit einem unerfüllten psychischen Grundbedürfnis in Verbindung zu bringen. Das Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden, gebraucht zu werden, produktiv zu sein, sich sicher fühlen, haben alte Menschen immer noch sehr stark. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass desorientierte Menschen immer mit der Hand auf den Tisch schlagen, dass eine Frau stets die Handtasche ein - und auspackt, das ein Mann die Zeitung in kleine Teile zerreißt. Würde ich ihm die Zeitung aus der Hand nehmen finge er bestimmt an zu schreien. Ich hätte ihm dann seine Arbeit von früher weggenommen. Nehme ich die Zeitung nicht weg, sondern anerkenne die Wichtigkeit seiner Arbeit. Es geht darum das ich empathisch mit dem anderen umgehe. Wenn die Sprache verloren geht, treten vertraute Bewegungen an ihre Stelle.
Berühren
In der Validation ist Berühren eine wichtige Technik außer bei Menschen mit mangelhafter Orientierung, die eher auf Distanz bleiben möchten. Zeitverwirrte Menschen und Menschen in der Phase der sich wiederholende Bewegungen dagegen freuen sich über Berührungen. Sie haben viele ihrer sozialen Hemmungen verloren. Sie finden sich oft zeitlich und räumlich nicht mehr zurecht. Durch Berührungen können bei diesen Menschen Erinnerungen und Gefühle wachgerufen werden, wenn man Menschen in der vierten Phase, dem Vegetieren validiert ist Berührung die erste und wichtigste Technik. Oft ist es der einzige Weg um noch Kontakt aufzunehmen.
Beispiel: Leichte kreisförmige Bewegungen mit der Handfläche auf der oberen Wange stimuliert Gefühle des „Von Mutter umhegt sein“
Eine reibende, kräftige Bewegung mit der Hand auf der Schulter und den Schulterblättern stimuliert das Gefühl „ein Bruder, Schwester oder guter Freund“ zu sein, eine geschwisterliche Beziehung. (Naomi Feil: „Validation, Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen“ 1999, S.77)
Musik einsetzen
Musik, die uns von früher vertraut ist, begleitet uns ein Leben lang. Ich habe oft erfahren das desorientierten Menschen die ihre Sprachfähigkeit verloren haben trotzdem noch den Text von vertrauten Liedern singen können und große Freude daran haben. Musik ist ein wertvolles Werkzeug, das in jeder Phase angewendet werden kann, Musik ist ein Weg um Gefühle auszudrücken. Menschen in der Phase des Vegetierens sprechen oft noch auf Musik an, besonders wenn sie für sie eine persönliche Bedeutung hat. Es ist dann natürlich von Vorteil, wenn man einiges aus ihrer Biografie kennt.
Ich arbeitete mit demenzkranken Bewohnern in einem Alten- und Pflegeheim. Die Betreuung, das Pflegen und Begleiten dieser Menschen stellte hohe psychische Anforderungen an Personal und Angehörigen. Weil man das Verhalten der desorientierten Menschen nicht verstehen kann, wird man ihnen oft nicht gerecht.
Begleitende Personen möchten z.b. diese Menschen wieder in die Realität zurückholen und sie werden frustriert, manchmal sogar wütend, wenn es ihnen nicht gelingt. Oder diese Personen werden wie kleine Kinder behandelt, zurechtgewiesen und belehrt.
Die demenzkranken Menschen spüren das Unverständnis in ihrer Umwelt, sie fühlen sich ungeliebt, wertlos und ihrer Würde verletzt. So ziehen Sie sich innerlich immer mehr zurück bis hin zu Vegetieren.
Für die Demenzerkrankung gibt es noch keine Heilung, es entsteht oft Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Die Krankheit macht Angst, denn sie kann jeden von uns treffen.
Da die Menschen immer älter werden, nimmt auch die Zahl der Demenzkranken zu.
Desorientierte zu pflegen und zu betreuen kann zu einer Überforderung des Personals führen.
Als Pflegerin ohne spezifische Kenntnisse im Umgang mit Demenzerkrankung habe ich diese Menschen viele Jahre lang begleitet. Ich war voller Enthusiasmus, Idealismus und Entschlossenheit meine Patienten gut zu betreuen. Meine Erwartung diesen Menschen im Heim ein „Zuhause“ bieten zu können erfüllte sich nur unzureichend und ich wurde immer wieder enttäuscht. Trotz großer Geduld und gutem Zureden weinten sie oft, schrien oder flüchteten gar aus dem Heim.
Als Pflegeteam fühlten wir uns oft überfordert und wir wussten, dass unser persönliches Engagement und unsere Ressourcen nicht reichten, um diesen Bewohnern gerecht zu werden.
Ich lernte die Validationsmethode als Techniken für die Kommunikationsform im Umgang mit Demenzerkrankten.
Wertschätzung, Akzeptanz und Mitgefühl gehören zum beruflichen Selbstverständnis und sind eine Grundhaltung. Ziel der Validation ist die Stärken und die Entwicklungsfähigkeit der jeweiligen Klienten aufzudecken und zu fördern.
Hier geht es nicht um Verbesserung der Kompetenzen, sondern um „Würde und Wohlbefinden“ dieser Menschen. Auch kann Validation einer Verschlechterung der Erkrankung Einhalt gebieten oder diese verzögern.
Im Ergebnis kann durch Validation das Leben dieser alten Menschen an Qualität gewinnen. Das Verb „validieren“ bedeutet soviel wie anerkennen, bejahen, jemand sein Recht zuerkennen, in seinem Recht bestätigen.
Feil, N. (2004) Validation. In Anwendung und Beispielen.
4. überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag
ISBN 3-497-01687-X
Feil, N./Rubin,V. (2005) Validation. Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen.
8. überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag
ISBN 3-497-01794-9

